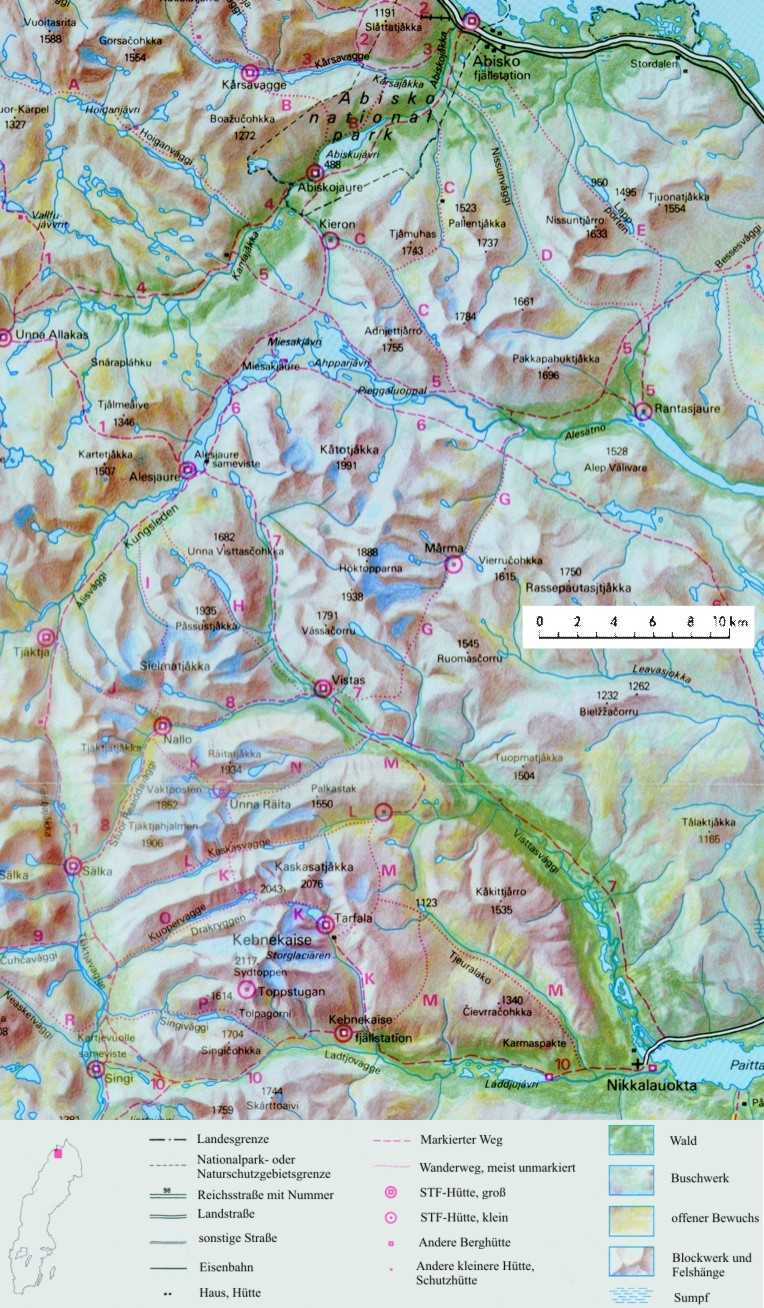Beschreibungen von Claes Grundsten

Claes Grundsten, Vandra Kungsleden, S. 148
Strecke K: Nallo -Tarfala - Kebnekaise Fjällstation
Für Freunde von karger Hochgebirgsnatur ist dieser Weg durch das Herz der Kebnekaise ein Wunschtraum.
Es bieten sich unvergeßliche Ausblicke auf die alpinste Landschaft, die unser Land aufweisen kann. Aber man
muß auf ansehnlich Kraftanstrengungen über drei Pässe eingestellt sein. Fünf Hochgebirgstäler werden durchquert.
Die Strecke wird oft Dreipaßweg oder Jojo-Weg genannt.
Strecke: ca. 30 km
Höhenunterschied: zusammen + 1185 m, -1350 m
Schwer bis sehr schwer
Geologische Besonderheiten, Schöne Ausblicke
Um von der Nallo-Hütte ins Unna Reaiddavaggi zu kommen, folgt man dem Weg knapp 2 km nach Süden,
wobei man über relativ steile, grasbewachsene Hänge steigt. Nachdem man den Fluß vom Reaiddajavri
durchwatet hat, geht es weiter bergauf, nun dominieren Blockfelder. Hier gibt es Lehrbuchbeispiele von
Blockströmen. Das sind abschüssige und langgezogene Stränge von angehäuften Blöcken, die durch
ein Zusammenwirken von Frostsprengung und Schwerkraft entstehen.
Hinter einem, d.h. im Westen, erhebt sich das Tjaktjatjåkka-Massiv mit einer charakteristischen Pyramidenform.
Wenn man oben angelangt ist und ins Unna Reaiddavaggi kommt, öffnet sich eine herrliche Hochgebirgslandschaft,
die umso großartiger wird, je weiter man ins Tal vordringt. Obwohl das Tal in die alpine Vegetationszone gehört,
wo Blockwerk dominiert, geht es sich relativ leicht; die Blöcke sind klein und flach, und dazwischen liegt viel feine
Erde. Die Wasserscheide (1300 m) ist stark zur westlichen Mündung des Tales hinverschoben und bildet den Kamm
des Berges. Auf der Südseite vor dem Vaktposten erhebt sichhier ein außergewöhnlich hoher und eindrucksvoller
Moränenrücken, einer der größten im Gebirge. Er hat einen Eiskern, der durch den aufliegenden Moränenschutt
gegen Abschmelzen geschützt wird. Der steile Gletscher oberhalb des Gletschers macht zusammen mit den senkrechten
Wänden des Vaktposten einen alpinen Eindruck. Der Gletscher bildet am Schmelzwassersee, der hinter einer Moräne
verstäckt liegt, einen Eisbruch.
Die Lanschaft vor einem wirkt so steril wie nur denkbar. So gut wie alle höheren Pflanzen fehlen. Die Gipfel
der Pyramide (1900 m) und des Knivkamm (Messerkamm, 1878) dominieren die Perspektive. Man kommt an ein
paar Seen vorbei und sieht danach immer mehr vom Reaidda-Gletscher und dem großen, türkisblauen See unterhalb
seiner Eiszunge. Auf der anderen Seite des Sees zeigt sich die Unna Räita-Hütte. Auf dem Weg dorthin geht man an
ein paar Felsbändern am Ufer entlang. Die Hütte hat zwei Pritschen mit Platz für vier Personen.
Strecke: 7 km
Höhenunterschiede: +350 m
Dauer: 3-4 Stunden
schwer
schöne Ausblicke
Die Unna Räita-Hütte (1260 m)
Das Unna Reaiddavaggi ist ohne Zweifel eins von Lapplands sehenswertesten Hochgebirgstälern und die Hütte liegt sehr schön.
Die Umgebung rundherum wird oft mit Spitzbergen verglichen, und vor allem der Anblick der Eiszunge des Reaidda-Gletschers,
die sich mit einem kleinen Eisbruch über dem See erhebt, erweckt den Eindruck, dass man sich en einem arktischen Ort mit
einem Inlandseis hinter dem Berg befindet. Die Form des Vaktposten (Wachposten, 1852), verstärkt dieses Gefühl. Die Kammlinie
des Berges mit drei Zinnen scheint vom selben Architekten geschaffen worden zu sein wie die berge auf Spitzbergen. Und der Berg
erhebt sich von Reaidda-Gletscher als wäre er ein isolierter Nunatak im Inlandseis. Näher an der Hütte steht der Knivkamm (Messerkamm, 1878 m)
senkrecht und hoch wie ein Turm mit unbezwingbaren Steilhängen. Gegen Osten folgen zwei weitere Bergriesen, die Pyramide (1900 m)
und Nipals (1902 m).
Die Hütte liegt auf einer 150 m hohen Felsschwelle, die das Unna Reaiddavaggi wie eine riesige Treppenstufe absperrt. Das Tal ist auf diese Weise
in zwei unterschiedlich hoch gelegene Teile aufgeteilt. Über die dazwischenliegende Kante stürzt eine Fluß mit schönen Schleierfällen
hinunter zu einem anderen See weiter unten. Die Hütte liegt luftig auf der Kante. Die Schwelle ist durch Gletschererosion enstanden, wahrscheinlich
lag ein Gletscher im östlichen, tiefer gelegenen Teil des Unna Reaiddavaggi.
Tagestouren
Strecke: ca. 5 km hin und zurück
Höhendifferenz: +670 m
Dauer: 5-7 Stunden
Auch die Pyramide (1900 m ) südöstlich der Hütte kann vom Paß Richtung Knivkamm bestiegen werden. (Strecke L).
Strecke: ca. 8 km hin und zurück
Höhendifferenz: +640 m
Dauer: 6-8 Stunden
Strecke: knapp 10 km hin und zurück
Höhenunterschied + 590 m
Dauer: 7-9 Stunden
Hochgebirgsausrüstung, schöne Ausblicke
Zwei kurze Ausflüge von der Hütte aus sollen noch erwähnt werden. Als Rundtour kann man zu dem See unterhalb der
Felsschwelle gehen. Wählt man auf dem Hinweg die Nordseite, so folgt man einer rinne. Unter dem Felsabsatz schimmert
der schöne Wasserfall, der über zwei Stufen geht. Der Fluß kann unter dem Wasserfall durchwatet werden. Auf dem
Rückweg auf der Südseite der Schwelle geht man auf einem stark geneigten Lawinenhang mit losen Blöcken.
Strecke: ca. 2 km
Höhenunterschied +- 180 m
Dauer: 3-4 Stunden
geologisch interessant, schöne Ausblicke
Direkt nach der Unna Räita-Hütte kommt man zum ersten Paß auf dem Weg nach Tarfala. Diese Strecke bedeutet
normalerweise, daß man zwischen Knivkamm und Pyramide über den Gletscher wandert. Dieser ist relativ steil
und exponiert entlang dem Knivkamm, wird jedoch zur Steilwand der Pyramide flacher. Vom Lawinengelände bei
Unna Räita-Hütte ist es eine kurze, exponierte Strecke, meist schneebedecktes Eis. Hier kann man Stollen
oder Steigeisen benötigen, wenn das Eis freigeschmolzen ist. Wenn man diese nicht hat, geht man am besten
hinunter zum See unterhalb der Felskante und sucht sich dann einen Weg zum Lawinenhang der Pyramide, von wo
man zum Paß gehen kann, ohne auf dem Gletschereis zu gehen. Nach ein paar Hundert Metern nach dem Lawinengelände
wird der Gletscher flacher und man geht schräg hoch zur Ostseite des Passes. Dort oben kann man die Aussicht
auf die Kammlinie des Knivkammes bewundern.
Weg K
Auf der Rückseite (d.h. Südseite) des Passes liegt Kaskasavagge und der Abstieg zum Tal ist kein Problem, oft
gibt es hier einige Schneefelder. Wenn man aus Süden hierherkommt, ist es wichtig, sich auf der Paßhöhe nah
an der Pyramide zu halten, denn sonst riskiert man, oberhalb eines Steilhanges am Knivkamm herauszukommen.
Auf der anderen Seite des Kaskasavagge kann man gut den Sattel im Bergrücken des Tuolpanjunnjetjåkka (1730 m)
erkennen, wo der nächste Paß liegt. Die Bergrücken lösen sich gegenseitig parallel nach Süden hin ab.
Hinter dem Tuolpanjunnjetjåkka erahnt man den Drakryggen (Drachenrücken, 1821 m), der im Vergleich niedrig wirkt, und
dahinter den monumentalen "Wolfsrücken" des Kebnekaise.
Unten im Kaskasavagge, das von Weg L durchquert wird, kann man Zeltplätze finden.
Nach einem halben Kilmoneter nach der Biegung um den Gaskkasbakti geht man über eine Schwelle (ca. 1480 m) und sieht
dann hinunter zum Gaskkasjavri, der oft schwarzer See genannt wird. Es ist der zweithöchstgelegene See des Landes
(1448 m) Oft liegt am Westufer ein Schneebruch. Hoch oben im erblickt man den drohenden Steilhang des Gaskkasbakti.
Hinter dem See hält man sich oben Richtung Giebnebakti, um den Abhang zum Tarfalavagge zu meiden. Von der Kante
des Abhanges kann man in das tiefe Tal mit dem schönen See Darfalajavri hinabsehen. Hinter dem See sieht man die
Touristenhütte und noch weiter hinten die Hüttenansammlung der wissenschaftlichen Station. Der Abstieg erfolgt an der
Kante des Gletschers, der in einem Eisfall mit tiefen Spalten und hohen Eistürmen hinunter zum Darfalajavri stürzt.
Man geht auf einem sehr steilen Seitenmoränenrücken und erreicht nach fast 300 m Abstieg das blockreiche Nordufer
des Sees. Hier liegen oft noch Schneefelder, der die Wanderung etwas vereinfachen. Die Steigung wird östlich des Sees
geringer und das letzte Stück und das letzte Stück zur Tarfala-Hütte geht sich bequem.
Strecke: 13 km
Höhenunterschied + 200 m, -260m, +280 m, -290 m, +290 m, -300 m
Dauer: 6-8 Stunden
sehr schwer
Hochgebirgsausrüstung, schöne Ausblicke
Die Tarfala-Hütte (1189 m)
Es ist schwierig, die Großartigkeit der Natur zu beurteilen, aber die Tarfala-Hütte liegt in einer Umgebung,
die gerne mit Superlativen beschrieben wird. Das Wort Tarfala bedeutet "der Ort, wo Moos wächst". Das Tal
ist wohl das bekannteste Tal im Kebnekaisegebiet und hat kein Gegenstück im Land. Direkt bei der Touristenhütte
liegt der Norra Klippberg (1711 m, der Name steht niht auf der Karte), dessen Felswand eindrucksvoll, aber
gleichzeitig ein Zwerg in dieser Umgebung ist. Hoch oberhalb seines Gipfels wird der Blick vom "Wolfsrücken"
des kebnekaise gefesselt. Die verschiedenen Höhen der Gipfel geben der Landschaft eine Wirkung sowohl in die
Tiefe als auch in die Höhe. Der Darfaljavri, dessen Strandlinie an der Hütte sich je nach Wasserstand ändert,
ist mit seinem grünschimmernden Wasser eine Genuß für das Auge. Die Farbe rührt vom Geltscherschlamm und dessen
Zusammensetzung her. Der See ist 52 m tief, und früher gab es einen hohen Eisbruch im Nordwesten, wo eine Eiszunge
zum See reicht. Durch den Rückzug des Eises hat es aufgehört, in den See zu kalben, d.h. unter getöse Eisberge
in den See abzugeben. Aber auch heute noch schwimmen bisweilen große Eisblöcke im Darfalajavri. Direkt nördlich
der Hütte dominiert der Gaskkasbakti (2043 m) und dessen Kammlinie zum Kakasatjåkka (2076 m) den Blick.
Mitten zwischen diesen Gifeln hat der Kamm einen charakteristischen Buckel, der Liljetoppen (Liliengipfel, 1904 m)
genannt wird (Der Name steht nicht auf der Karte). Die Berghänge zwischen diesen Gipfeln sind besonders kompakt
und hoch und an ihren Füßen liegen schöne Beispiele von Blocklawinenzungen. Wenn es windstill ist, spiegeln sich
die Berge wunderschön im See. Das Tal ist allerdings berüchtigt für seine harten Fallwinde, die oft bei Föhn-
Wetterlagen entstehen, wenn der Westwind eine mauer von Regenwolken um das kebnekaisemassiv legen, wo Niederschlag fällt.
Heftige Windausbrüche mit trockener Luft können bei diesen Gelegenheiten in das Tal hinabstoßen. Im Winter wurden
einige male 50 m/s gemessen.
Die Hütte wurde 1988 neu gebaut und hat 22 Schlafplätze und eine kleinere Wirtshütte. Im Blockgelaände rundherum wurden
Zeltplätze freigeräumt, die mit Steinmauern markiert sind.
Es gibt viele Ziele für Besteigungen, auch wenn man Kletterei vermeiden will. Der Gipfel, der normalerweise empfohlen wird
ist der Kakasatjåkka (2076 m), dier vierthöchste des Landes. Der Gipfel ist angeblich der beste Aussichtsgipfel
im gesamten Kebnekaisegebiet, aber darüber kann man diskutieren. Der Tarfalatjåkka (1904 m) bietet eine ähnliche
Aussicht.
Eine Besteigung des Kakasatjåkka setzt Gletschererfahrung voraus, da der Normalweg über den kleinen Gletscher
südöstlich des Gipfels führt. Seine Zunge ist stiel und Eisausrüstung wird normalerweise eingesetzt. Die geringste
Neigung findet man am nächsten am Tarfalatjåkka. Der obere teil des Gletschers ist auch etwas weniger steil, und
um den Paß zwischen Kakasatjåkka und Tarfalatjåkka zu erreichen, besteigt man einen Blockhang. Vom Paß folgt man
dem ostkamm zur Gipfelmarkierung. An einigen Stellen muß man sich mit den händen abstützen. Die Aussicht ist grandios
in alle Richtungen. Nach Norden und Westen häufen sich die Bergrücken unübersichtlich, doch mit Hilfe der Karte kann
man scharfe Profile identifizieren, z.B. den Knivkamm und die Hök-Gipfel. Nach Süden ist der Südgipfel des Kebnekaise
die unverkennbare Richtmarke, von dieser Seite vielleicht am allerschönsten. Zurück folgt man demselben Weg. Man kann
aber auch über den Gipfel weitergehen über den Westkamm zum "Liljetopp" (1904 m). Im Paß unterhalb des Westkamms des
Kakasatjåkka befindet sich eine Gedenktafel für die zwei Kletterer Tore Rydberg und Volmar Skoglund, die 1941 an der
Nordwand verunglückten. Der Kamm setzt sich vom Liljetopp fort zum Gaskkasbakti (2043 m), aber dieser Weg erfordert mehr
Erfahrung mit Kletterei. Der Gaskkasbakti ist einer der 4-5 berge in Schweden, wo man reine Kletterpassagen bei einer
Besteigung nicht vermeiden kann. Vom Liljetopp kann große Schneefelder nutzen, um zum Darfalajavri hinunterzugleiten.
Strecke: 8-10 km
Höhenunterschied + 900 m
Dauer: 8-10 Stunden
Hochgebirgsausrüstung, schöne Ausblicke
Ein schöner Tagesausflug ist auch, sich die Landschaftsformen im Tal anzusehen. Vor dem Isfalls-Gletscher liegt z.B.
eine Serie Endmoränenrücken von unterschiedlichem Alter, der eine hinter dem anderen. Während der letzten maximalen
Ausbreitung des Gletschers im Jahre 1915 stand die Eiskante 100 m vom äußersten Rücken. Dieser stammt also von
einem älteren maximum. Zwischen den Rücken und der heutigen Gletscherfront liegt sogenannte "fluited moraine".
Der Begriff bezeichnet die merkwürdigen parallelen kleinen Rücken, die bei bestimmter Beleuchtung an Ackerfurchen
auf einem frischgepflügten Acker erinnern. Sie liegen in der Bewegungsrichtung des Eises ausgestreckt und wirden hinter
anstehenden Blöcken unter dem Eis gebildet. Die Forscher meinen, daß sie mit den Drumlins der norrländischen Wald-
und Küstenlandschaft verwandt sind. Auch große Seitenmoränenrücken können studiert werden, besondern beim Stor-Gletscher
(großen Gletscher). Diese bilden sich an der Seite, und ncniht an der Front des Gletscher, wie die Endmoränen.
Auf dem Spaziergang kann man bei der Forschungsstation vorbeigehen, die in diesem weglosen Land eine unerwartet große
Anlage darstellt. Sie wurde vom Glaziologen Walter Schytt aufgebaut, und schon 1948 wurde die erste Hütte hierhergebracht.
Jetzt steht hier eine moderne Anlage mit Werkstätten, Laboren, Sammlungsraum usw. Insgesamt können bis zu 35 Personen in
der Station unterkommen, die vom Naturgeographischen Institut der Universität Stockholm verwaltet wird.
Botanisch interessante Lokale liegen südlich der Forschungsstation. Am Hang Richtung Ladjovagge befindet sich eine
Grenze zwischen verschiedenen Gesteinsschichten, erkennbar als Steilkante quer durch den Talboden. Hier gibt es weichere
Schiefergesteine, welche die Flora begünstigen. Am Hang verstreut wachsen kalkliebende Arten wie Silberwurz
(Dryas octopetala),
Rauhhaariges Läusekraut (Pedicularis hirsuta) und Roter Steinbrech (Saxifraga oppositifolia).
Von der Tarfala-Hütte geht ein markierter Weg hinunter zum Ladjovagge und zur Kebnekaise Fjällstation. Das Tarfalavagge
ist verhältnismaßig schmal in diesem Teil und entlang der Westseite sieht man die Kante der Gesteinsscholle in Form eines
steilen Hanges. Am Fuß gibt es Erdravinen. Wo der Weg die Schollengrenze passiert, liegt der sogenannte "große Hügel", und
der Darfaljohka wird zusammengedrängt. Eine kleine Anlage zur Messung der Wasserführung steht über dem Fluß. Am Hang
befindet sich auch eine Gedenktafel für Walter Schytt, befestigt an einem großen Block. Parallel zum Weg führt die Stromleitung,
die die Firschungsstation versorgt. Weiter unten, näher an der Mündung, kommt man in Birkenwald. Der kräftig strömende
Darfaljohka wird über eine Brücke überquert, wo man den großen Weg von Nikkaluokta trifft (s.u.). Hier gibt es ein paar
Trockentoiletten. Nach der Brücke bleiben noch 2 km leichte Wanderung zur Fjällstation.
Strecke: 8 km
Höhenunterschied -480 m
Dauer: 2-3 Stunden
leicht
Dieser leichte Weg mit wenig Höhenunterschieden folgt auf der ganzen Strecke dem Ladtjovagge, und man gelangt vom
großen, weglosen Gebirge im Westen zum Tiefland im Osten. Der Name des Tales bedeutet übersetzt aus dem Samischen
"Heutal". Sein westlicher Teil ist eng und tief eingeschnitten, aber im zentralen Teil wird es breiter und fruchtbarer,
und gleichzeitig werden die hänge flacher. Kommt man von Nikkaluokta, trifft man auf einen eindrucksvollen Eingang
in die Bergwelt mit bildschönen steilen Bergen und dem Blick auf die höchsten Gipfel Schwedens. Im östlichen Teil liegt
auch ein großes Deltagebiet im See Laddjujavri, das man mit dem Boot durchquert.
Etappe Singi-Kebnekaise
Der Weg von der kebnekaise Fjällstation nach Osten ist vielbegangen und breit. Bis zum Darfalajoka wächst schütteter
Birkenwald. Nach der Brücke über den Fluß, der in einen Canyon stürzt, kommt man in einen geschlosseneren Bergbirkenwald
und der restliche Weg liegt in dieser Vegetationszonoe. Die Wnaderung führt erst hinunter zum Laddjujohka. Der Blick zurück
zeigt Kaipak und die Fjällstation sowie die Berge rund um das Ladtjovagge. Eine Weile ist sogar der Gipfel des Gaskkasbakti
(2043 m) durch das enge Tarfalavagge zu sehen. Vor einem sieht man die niedrigen Fjällebenen südlich des Ladjovagge.
Der weg fürht durch große Blöcke unterhalb des Steilhangs des Darfaloagis (750 m). Hier wächst Hochkrautvegetation und
der Wald ist sehr üppig. Der Hang ist kalkreich und bildet die Grenze zwischen zwei Gesteinsschollen. Man findet
anspruchsvolle Pflanzen, wie z.B. einen gelbblühenden Steinbrech (Saxifraga cespitosa), Roten Steinbrech
(Saxifraga oppositifolia), Felsen-Ehrenpreis (Veronica fruticans Jacq.) und Felsen-Segge
(Carex rupestris All.).
Nach der Kante wird es hügelig bis zum Flußbett des Laddjujohka. Der Fluß bildet hier ein großes Delta in den See
Laddjujavri. Seit dem Ende der letzten Eiszeit wurde der Gletscherschlamm vom Kebnekaise hier abgelagert und hat
den See um die Hälfte verkleinert. Im Delta gibt es Marsch, abgeschnürte Seen, Kanäle und Meanderschlingen; ein
üppiges Gebiet für Wasservögel.
An der Stelle, wo der Weg den Fluß berührt, liegt ein kleiner Steg, von wo Bootstouren zum Ostufer des Laddjujavri gehen,
wo das Boot stationiert ist. Diese Transportmöglichkeit erlaubt es einem, 7 km Wanderung am Nordufer des Sees zu sparen.
Die meisten Wanderer nutzen dies aus aun es gibt einen festen Fahrplan. Die Fahrt ist ein Erlebnis für sich, weil man so
direkten Kontakt zum Delta bekommt und die schnell wechselnden Bergperspektiven hiniter dem Wasserspiegel bewundern kann.
Beim östlichen Bootsanlegeplatz befindet sich eine Kaffe-Hütte mit Bedienung. Die restliche Strecke nach Nikkaluokta
geht sich sehr leicht. Der Weg ist so breit wie ein Traktorweg. Direkt hinter der Kaffee-Hütte geht man über eine Kante,
von wo der Blick zurück, d.h. nach Westen zum Südgipfel und Tolpagorni, bildschön ist. Nach Süden wird der Blick von
einer tiefen und mächtigen Spalte im Berghang gefangen, Stallegorsa. Sie wurde vermutlich vom Schmelzwasser des
Inlandseises ausgeschürft. Der Hang südlich des Ladtjovagge hat auch viele deutliche, fast parallele Linjen, die
das Interesse wecken. Das sind sogenannte Eisrandrinnen und wurden vom Schmelzwasser gebildet, das zwischen einer Eiszunge
und dem Berghang floß. Man sieht die Vertiefungen, die das Wasser in den Boden gegraben hat. Die Abfolge der Rinnen
zeigt, wie das Eis nach und nach zusammensank. Der Cievrajohka wird über eine Brücke überquert, und ganz in der Nähe
gibt es schöne Rastplätze. Das erste, was man von Nikkaluokta erblickt, ist die kapelle, die schön auf einem Hügel
gelegen ist.
Strecke: 19 km (- 7 km Bootsfahrt)
Höhenunterschied -220 m
Dauer: 5-6 Stunden
leicht
Vögel, Flora, Geologie
Die Kebnekaise Fjällstation (690 m)
Das erste Haus wurde schon 1907 aus lokal gewonnenen Steinen gebaut. Diese Haus wurde später ersweitert
und ist auch heute ncoh Teil des Hauptgebäudes. Hier haben die Wände auf diese Weise eine Patina aus der
Anfangszeit des Tourismus. Später kamen mehrer Gebäude hinzu. Heute besteht die Fjällstation aus dem
erweiterten Haupgebäude mit Restaurant und Aufenthaltsraum sowie drei freistehenden Gebäuden mit insgesamt
160 Schlafplätzen. Es gibt ein öffentliches Telefon und einen Laden mit u.a. Proviantverkauf. Hier kann man
auch Hochgebirgsausrüstung mieten. Für Camper gibt es ein Servicegebäude mit Dusche, Sauna und Küche.
Zeltplätze gibt es auf dem Hang hoch zum Kaipak. Ein zusätzliches Gebäude mit Kochplatten ist das ganze
Jahr über geöffnet. Während der Touristensaison stehen Bergführer zur Verfügung, u.a. um auf Touren auf den
Gipfel des Kebnekaise zu führen. Es werden auch Gletscherwanderungen und Klettertouren arrangiert.
Wenn das Wetter gut ist, lockt eine Besteigung des Kebnekaise. Kein Ziel erscheint einen Kenner der Berger
naheliegender. Man kann zwischen zwei Wegen wählen: der eine, der "Westweg" genannt wird, ist lang, aber nicht
besonders exponiert, der andere, der "Ostweg", ist direkter und ausgesetzter.
Der Westweg beginnt oben im Kitteltdal (Kesseltal, der Name steht nicht auf der Karte). Um dorthin zu gelangen,
geht man von der Station auf dem Weg zum Tolpagorni nach Westen und dann bergauf in einem schmalen Bacheinschnitt
nördlich davon. Das Kitteldal ist, wie der Name sagt, ein stattlicher Kessel umringt von steilen Abhängen.
Besonders auffällig ist eine sehr stiele und lange Schneerinne auf dem Berg Vierranvarri (1711 m). Dieser Berg -
früher im Spaß "Rullevara" genannt, weil ein Besteiger des Berges mit Namen Rudolf Berg, der Steine ins Rollen
brachte - hat riesige Blockflächen, die überwunden werden müssen. Der Kittelbäck (Kesselbach) muss hoch oben
im Tal durchwatet werden und danach geht man steil hoch zum Paß (1440 m) südlich vom Vierranvarri. Hier wächst
Eisranunkel und als belohnung für den steilen Aufstieg bekommt man eine schwindelerregende Aussicht hinunter
ins Singivaggi. Vom Paß aus ist es einfach, den Gipfel des Tolpagorni 200 m durch Blockgelände zu besteigen.
Der Westweg setzt sich jedoch nach Norden fort, zum gipfel des Vierranvarri, von wo die Aussicht eine seltene
Tiefenperspektive zur schmalen Kluft des Singivaggi und dem Ladjovagge dahinter bietet.
Zum Abschluß geht man hoch über das Gipfelplateau des Kebnekaise, wo es ebener wird. Oberhalb erhebt sich
der Gipfel, welcher ein Gletscher ist, 40-50 m dick und als große Pyramide geformt. Das ist die Sahnehaube
des Bergmassivs, ein 2000 m-Gipfel mit Eis und weißem Schnee auf schwarzem Fels. Die letzte Steigung ist
abhängig von der Schneemenge. Die Höhe hat deshalb mit den Jahren variiert. Auf der Karte werden 2117 m
angegeben, aber der Mittelwert der letzten 20 Jahre ist 2114 m. Im Winter ist er immer ein paar Meter höher.
Der nordgipfel des Kebnekaise (2097 m) ist der höchste Punkt des Landes auf festem Boden. Die Aussicht vom
Südgifel ist erstklassig. Angeblich kann man bei guter Sicht ca. 40000 km2 oder 8% der Landsfläche überblicken.
Man sieht 100 bis 150 km weit. Nach Norden ziehen sich Unmengen von Gipfeln und Gletschern. Mit dem Fernglas
kann man viele Gipfel identifizieren, sogar die weit entfernten wie das Storsteinsfjell im Narvikgebiet.
Einem zu Füßen liegt einen Alpenlandschaft mit allem, was es so gibt an komplizierter und wilder Topographie,
Schluchten und Gletscher. Gleichzeitig blickt man über eine Wildnis, wo die Täler unberührt sind. Diese Kombination
ist im internationalen Vergleich der höchste Wert unserer Gebirgskette. Selten wird es so deutlich wie vom
Sügipfel aus. Auch nach Süden breiten sich Wellen von hohen Begen und Hochebenen aus. Weit entfernt ligt die
Bergwelt des Sark-Nationalparkes. Nur nach Östen sieht das Panorama anders aus. Hier dominieren die dunklen
Farbtöne des Waldlandes und flache Landformen. Der Gipelgletscher ist ein schmaler Rücken und er geht unmittelbar
in luftige Abhänge zum Rabots-Gltescher im Westen und Stor-Gletscher (großer Gletscher) im Süden über.
Der Rückern setzt sich zum Nordgipfel des Kebnekaise fort, aber eine Überquerung dorthin sit nur mit
Steigeisen möglich, außerdem muß man Wandern auf Eis gewohnt sein und exponierte Passagen bewältigen.
Man muß kletterkundig sein, um weiterzugehen.
Um abzusteigen, folgt man dem Westweg hinunter. Das Schneefeld untem im Kitteldal kann auf dem Rückweg
trügerisch sein.
Strecke: ca. 24 km hin und zurück
Höhenunterschied: zusammen + 1620 m, - 200 m (beim Vierranvarri)
Dauer: 10-12 Stunden
schöner Blick
Der Ostweg ist ein kürzerer Weg hoch zum Südgipfel. Deshalb wird er von mehr Bergsteigern gewählt.
Auf dem Weg muß man sowohl einen Gletscher überqueren als auch einige Passagen mit leichter Felskletterei.
Unerfahrenen wird deshalb geraten, diesen Weg nur mit Bergführer zu wählen. Ist man jedoch gletscher- und
bergerfahren, ist es jedoch selten problematisch, den Weg auf eigene Faust zu gehen. Man folgt dem Weg von der
Fjällstation zum Tolpagorni. Auf dem Hang untehalb des Kebnetjåkka ist die Vegeation stellenweise reich,
u.a. wächst hier die Kronlose Nelke (Silene wahlbergella Chowdhuri). Beim sogenannten Jäkelbäck (Jökelbach, der Name ist nciht auf der Karte)
biegt man ab in den Einschnitt hoch zum Gletscher unterhalb des Gipfels des Kebnetjåkka (1763 m). Der Bach
kann bei ca. 1050 m leicht durchwatet werden und danach folgt eine kräftige Steigung hoch zur Ebene oberhalb
des kleinen Gletschers. Hier kann man auf Stielloses Leimkraut (Silene acaulis), Zarten Enzian (Gentianella tenella)
und Schnee-Enzian (Gentiana nivalis) treffen.
Oben beim Plateau kommen die hohen Bergwände des Kebnekaise in Sicht - die konnte man vorher nicht sehen.
Die Ebene ist ein Überbleibsel von der Zeit vor 70 Mio. Jahren, als die Bergkette zu einer Ebene abgetragen
war und zu jener Zeit durch Bewegungen im Inneren der Erde angehoben wurde. Auf Blockgelände kommt man zur
Zunge des Björling-Gletschers, der zum Kitteldal hin liegt. Während der Wanderung über den Kamm der Eiszunge
muss man auf Spalten achten. Die Passage endet oben auf dem deutlcihen, meist schneebedeckten Drachenrücken, der
sich bis zur Felswand unterhalb des Gipelplateaus des Kebnekaise zieht. Der Rücken besteht aus Eis und hat
Gletscherspalten, die normalerweise vom Schnee versteckt werden. An der Felwand beginnt die Kletterei mit
einem luftigen Stück seitwärts, auf dem Gudjohnsen-Band nach Norden (der dänische Lehrer Th. S. Gudjohnsen
eröffnete den Weg 1919). Hier gibt es Markiereungen auf den Felsen, und die Flechten sind abgetreten, der Weg
ist mit anderen Worten leicht zu finden. Das Band ist teilweise nach außen geneigt, und lose Steine erfordern
besondere Aufmerksamkeit. Aber es ist nicht schwierig, vorwärtszukommen. Unterhalb des Bandes liegt der
Björling-Gletscher. Unten an der kante zu diesem Hang wächst der sehr seltene Bergmohn auf einigen Erdschollen.
Er kann vom Weg aus beobachtet werden, aber hinunter zu gehen ist zu riskant. Nach dem band muß man gerade
hoch in die Felswand durch die südliche von zwei Spalten, die beide hoch zum Gipfelplateau des Kebnekaise führen.
In der Spalte sind während der Sommersaison feste Seile als Hilfe befestigt. Die Kletterei wird als sehr
leicht eingestuft, und wenn man über die Kante kommt, sieht man die ältere Gipfelhütte. Zum Abschluß erreicht
man den Südgipfel nach 240 m Steigung von der Hütte. Zurück auf dem Ostweg.
Strecke: ca. 16 km hin und zurück
Höhenunterschied: + 1420 m
Dauer: 8-10 Stunden
Hochgebirgsausrüstung, schöner Blick
Strecke: ca. 10 km hin und zurück
Höhenunterschied: + 1070 m
Dauer: 4-5 Stunden
schöner Blick
Strecke: ca. 10 km hin und zurück
Höhenunterschied: + 600 m
Dauer: 4-5 Stunden
schöner Blick, geologische Besonderheit
Von der Kebnekaise Fjällstation kann man noch viele weitere interessante kürzere Tagestouren machen,
u.a. um an den Hängen Richtung Kittelbäck nach Pflanzen zu suchen. Man kann auch die Björngrotta
(Bärenhöhle) am oben erwähnten Blockrücken südlich des Laddjujohka aufsuchen. Sie liegt auf der
600 m-Höhenlinie und ist eine Blockhöhle. Eine andere geologische Sehenswürdigkeit ist das Gletschertopf-Feld
beim Kittelbäck, direkt südlich der Brücke. Gletschertöpfe sind perfekt geschliffene Löcher im Fels, die
durch die Schleifwirkung von Steinen in Wirbeln im brausenden Wasser entsatnden. Die Steine werden "Läufer"
genannt und liegen oft noch am Boden der Gletschertöpfe.
Das Tal, dessen samischer Name "Mitteltal" bedeutet, ist relativ gerade und gleichzeitig schmal und tief
eingeschitten. Es ist WSW-ONO orientiert und es durschneidet das Hochgebirgsmassiv des Kebnekaise.
Die Umgebung ist karg mit steinigem Boden und wilden Felswänden. Die Wanderung bietet alpine Erlebnisse
von höchster Klasse. Von Westen kommt man leicht hinein in das Tal, im Osten gibt es eine schlecht zugängliche
Rinne.
Strecke: ca. 20 km
Höhenunterschied: + 300 m, -600 m
Dauer: 8-10 Stunden
Schwer
schöne Ausblicke, keine Hütten
Etappe Sälka - Wasserscheide
Normalerweise verläßt man den Kungsleden einige Kilometer südlich der Sälka-Hütten und steigt hoch zum Eingang
des Kaskasavagge durch die langgestreckten Bergrücken Kaskasnjunjetjåkka (1721 m) und Tuolpanunjetjåkka (1792 m).
Der Fluß im Tal Gaskkasjohka hat einen kleinen Felscanyon in dessen westlichen Teil eingeschnitten, wo er
hinaus ins Tjäktjavagge fließt. Am besten geht man auf der nördlichen Talseite oberhalb des Canyons;
auf der Südseite ist das Gelände etwas steiler. Erst kommt man über ein paar Wiesen, gelangt dann aber schnell
in steinigeres Gelände. Die beiden Bergrücken auf den beiden Seiten des Tales sind nicht besonders steil, außer
in den oberen Bereichen, sondern sie geben dem Tal ein schönes U-Profil. In diesen Steilhängen sieht man
besonders viele Lawinenrinnen und Lawinenblockzunegen. Es fallen auch einige interessante Rücken quer durch das
Tal direkt bei der Mündung auf. Die Rücken haben ein ziemlich niedriges profil und sind Endmoränen eines
Geltschers. Wahrscheinlich wurden sie nach der Eiszeit gebildet, als ein Gletscher das Kaskasvagge ausfüllte.
In Gangrichtung sieht man zwei Berge, die das kaskasavagge einrahmen: die trotzige Pyramide des Nipals (1902 m)
und der zierliche Gipfel des Kuopertjåkka (1914 m). Weiter in Richtung Wasserscheide liegt ein schmaler See.
Dort haben die umgebenden Bergseiten alpine dimensionen mit Gletschern, die ins Tal fließen.
bei der Wasserscheide im Kasakasavagge (ca. 1200 m) wird das Tal von Paß zu Paß vom
Weg K
durchquert, der von den Unna Räita- zu den Tarfalahütten führt. Der Pässe sind deutlich zu sehen und man kann
seine Wanderung natürlich hoch zu einem der beiden fortsetzen. Man kann auch bei der Wasserscheide zelten,
wenn man sich in der Mitte des Tales hält; hier ist der steinige Boden mit Grasheide durchsetzt. Die
Pyramide (1900 m) erscheint von dieser Seite als der dominierende Berg im Norden.
Strecke: ca. 10 km
Höhenunterschied: + 300 m
Dauer: 3-4 Stunden
Schwer
schöne Ausblicke, keine Hütten
Von der Wasserscheide führt der Weg durch das Kaskasvagge bergab zum See in der schmalen Spalte zwischen
Nipals und Kuopertjåkka. Man geht entlang der Nordseite des Sees unterhalb der kräftig strukturierten und
faszinierenden Südwand des Nipals, wo mehrere Felstürme hoch oben nebeneinander stehen. Auf einem kurzen Stück
besteht das Gelände aus großen Blöcken und bei Regenwetter muß man vorsichtig sein. Auf der Südseite des Tales
sieht man von hier mit der Zeit immer mehr von einem ungewöhnlich hohen Moränenrücken, und dahinter erscheint
nach und nach die senkrechte 400 m hohe Nordwand des Gaskasbakti. Wenn man den Rücken überquert hat, der von
einer Seitenmorände gebildet wird, hat man einen Blick auf das ganze eindrucksvolle Gletscherbecken im Süden.
Der Gletscher, der keinen Namen hat, wird umringt von imponierenden Felswänden, die zu drei schwedischen
"Alpen" gehört: Der Kuopertjåkka (1914 m), Gaskkasbakti (2043 m) und der Kaskastjåkka (2076 m). Die Topographie
ist für unsere Verhältnisse sowohl groß in ihren Proportionen und und visuell spannend durch ihre scharfen
Formen. Das Gletscherbecken ist in zwei Teile geteilt. Mitten zwischen diesen steht ein schöner, markanter, aber
niedrigerer Gipfel (1682 m) mit steilen, glatten Felswänden.
Von diesem Moränenrücken sieht man, daß das Tal nach Osten hin einen anderen Charakter hat. Das Blockgelände
wird durch Grasebenen ersetzt. Die Seiten werden flacher und im Hintergrund verliert sich der Blick in den
flacheren Ebenen hinter der Talsenke des Vistasvaggi. Der östliche Zweig des Gaskkasjohka kann ohne Mühe
durchquert werden und man geht weiter auf der Südseite des Tals über Grasland auf den auffallenden Berg 1316 zu,
unterhalb dessen Gipfel eine Brücke über die steilen Flußufer führt. Man kommt dann zu einer Schutzhütte
mit isolierten Wänden und einem sehr guten Kamin. Hier können 4 Personen übernachten.
Die Steigung auf der Südseite des Tales ändert sich vom hohen Nordhang (2076 m) des Kaskastjåkka nach Osten
hin zu den flachen Hängen zur hochebene Tjeurelako hin. Auch auf der Nordseite wird das Tal flacher von
der Felswand des Nipals (1902 m)zu den Hängen des Palskastak (1550 m). Nach hinten, d.h. nach Westen, ist
eins der schönsten Panoramen der Kebnekaiseumgebung zu sehen, man blickt auf den schmalen Durchbruch
des Kasakasavagges bei der Wasserscheide, wo der Kuopertjåkka (1914 m) wie ein spitzes "Matterhorn" steht.
Die Fortsetzung von der Schutzhütte nach Osten ist schwerdurchdringlich. Das Tal verengt sich zu einem
sich schlängelnden Einschnitt mit Wasserfall und schließlich mündet es hinaus ins Vistasvaggi. Die Talseiten
in diesem Gebiet sind steil (V-Profil) und das Gelände fällt steil ab in tiefere Gebiete. Der Boden ist
unterhalb des Hangs im Einschnitt mit Blöcken übersät. Hier gibt es sogar direkt beim Zufluß auf der Norseite
eine Höhle, sie wurde schon als "Touristenherberge" genutzt. Die Vegetation wird außerdem dichter und Birkenwald
dringt vom Vistasvaggi her ein. Die Strecke ist sehenswert, aber kaum zu empfehlen, obwohl man einen alten
verwachsenen Weg finden kann. Man kann sie unter Umständen bewältigen, wenn man hinunter zu Lisas Hütte unten
am Strand vom Vistasjohka will. Die Hütte wurde 1933 gebaut und die Besitzerin war Lisa Zetterström aus Hörby,
die sie als privaten Rückzugsort im Gebirge nutzte. Heute ist sie in schlechtem Zustand, kann aber zur
Übernachtung genutzt werden.
Will man von der Schutzhütte zum oberen Vistasvaggi gelangen, folgt man besser
dem markierten Weg hoch zum Njunnji-Plateau bei 1000 m und dann geht man den 400 m-Hang hinab zum Birkenwald,
wo das Uann Reaiddavaggi mündet (Weg O).
Strecke: ca. 10 km zur Schutzhütte
Höhenunterschied: - 300 m
Dauer: 3-4 Stunden
Schwer
schöne Ausblicke
Dieser Weg ist relativ anstrengend mit mehreren Watstellen und steilen Hängen, die überwunden werden müssen.
Auf der Südseite des Vistasvaggi folgt man einem markierten Weg, der nach Kaskasavagge führt. Danach ist
das Gelände unmarkiert und oben auf der Hochebene Tjeuralako kann es bei schlechter Sicht schwierig sein,
sich zu orientieren. Auf der Wanderung kommt man durch die einsamsten Teile des südlichen Kebnekaisegebirges
und und bekommt sehr unterschiedliche Eindrücke. Der Blick und Natur ändert ihren Charakter vom fruchtbaren
Vistasvaggi bis zur arktischen Tundra auf der Hochebene Tjeuralako. Man hat auch schöne Blicke auf die
hochalpinen Gipfel im Westen und das Tiefland im Osten.
Strecke: 20-26 abhängig davon, wo man die Wanderung abschließt.
Höhenunterschied: zusammen + 1000, ca. -100 m
Dauer: am besten 2 Tage
Wat, keine Hütten
Früher folgte man von der Vistas-Hütte dem Weg (Nr. 7) ca. 1.5 km nach Süden, wo man abbog,
um den Vistasjohka direkt vor seiner S-Kurve dort zu durchwaten. Das kann man natürlich immernoch versuchen,
aber heute ist es besser die Brücke über den Vistasjohka direkt unterhalb der Hütten zu nutzen, und danach
sofort den Fluß vom Stuor Reaiddavaggi zu durchwaten. Die Wat stellt normalerweise kein großes Problem dar,
der Fluß kann direkt oberhalb der Mündung, wo er sich verzweigt, überquert werden. Nach dieser Passage sollte
man sich einen Weg zur Bergflanke des Reaiddacohkka oberhalb der Waldgrenze suchen und diese Höhe bis zur
Mündung des Unna Reiddavaggi halten, wo man hinunter zu den offenen Heideflächen im Birkenwald geht.
Hier trifft man auf den markierten Weg, dem man bis zum Fluß folgt, der aus dem Unna Reaiddavaggi kommt.
Der Fluß hat ein fächerförmiges, altes Delta mit vielen Armen (Schwemmkegel). Bei hohem Wasserstand kann
es mühsam sein, an ihnen vorbeizukommen. ...
Das Unna Räiddavaggi ist das vielleicht interessantesteste Tal. Die umgebenden Berge sind spektakulär und
schön in ihren Konturen. Das Tal hat außerdem eine merkwürdige Topographie und ist aufgeteilt in zwei
Ebenen mit einer 150 m hohen Felswand, die den oberen Teil vom unteren trennt. In der Wand reiselt ein
schmaler Wasserfall, der aus einiger Entfernung wie Silber leuchtet. Der Weg folgt dem östlichen, tiefer
gelegenen Teil des Tales hinein in dessen alpinen Mittelpunkt.
Strecke: 16 km zwischen Vistas- und Unna Räita-Hütte
Höhenunterschied: + 670 m
Dauer: 5-7 Stunden
Wat, schöne Ausblicke
Zu Beginn folgt man derselben Strecke wie auf dem Weg M, bis zum Schwemmkegel des Flusses an der Mündung des
Unna Reaiddavaggi. Dort verläßt man diesen Weg und geht statt dessen in Richtung des fast V-förmigen Tales
nach Westen. Das Gelände steigt vom Schwemmkegel mit seinen zahlreichen Armen hoch zum Steilhang des
Räitatjåkka. Die Wanderung wird anstrengend steil oberhalb des Bacheinschnittes im Boden des Unna
Reaiddavaggi. Die Durchquerung macht man am besten irgendwo in der Mitte. Weiter oben ist es steiler und steinig.
Man kann einen Weg suchen, aber mehrere Querbäche mit tiefen Einschnitten müssen durchquert werden. Der größte
von diesen kommt vom Geltscher des Räitatjåkka, und er fließt in einem tief eingeschnittenen Tal. Der Fluß
kann oft über eine Schneebrücke unterhalb eines Hanges mit Wasserfall überquert werden.
Nach diesem Fluß wird das Gelände flacher und es wird leichter, hier zu wandern, während die Lanschaft
dramatischer wird. Die steilen Gipfel Pyramide (1900 m) und der Knivkamm (1878 m) fangen den Blick. Hinter der
Querwand im Tal treten die obersten Zinnen und Türme des Vaktposten (1852 m) hevor. Die Talseiten werden
von unebenen Hängen mit Lawinenrinnen und Lawinenblockzungen geprägt. Und mitten im Blickfeld liegt unterhalb
der Pyramide ein kleiner, charakeristischer Berg mit einem 100 m-Abhang; ein Zwergenberg der wie eine Warze
in der Landschaft wirkt. Man setzt die Wanderung erst auf Heide und weiter innen auf Gras fort und reicht dann
den See unter dem Riegel im Tal. Der Aufstieg an der Felswand vorbei kann entweder auf der Süd- oder der
Nordseite erfolgen. Wenn man schweres Gepäck hat, geht man besser auf der Südseite. Man geht einen Lawinenhang
hoch bis zur Kante der Felsschwelle, wo die Unna Räita-Hütte liegt, 150 m oberhalb.
Der Mårmapaß bietet einen elganten Paßübergang zwischen den breiten Talgängen Alisvaggi und Vistasvaggi.
Es ist ein anspruchsvoller Weg, der in die unfruchtbaren Regionen des Hochgebirges führt. Hier ist man
gezwungen, durch Blockmeere und Schneefelder zu gehen. Darüber hinaus, daß der Mårmapaß als Verbindung
zwischen den Tälern darstellt, ist er eine Herausforderung für starke Wanderer. Bei schönem Wetter mit
gepäck hoch zum Paß zu gehen ist ein wunderbares Erlebnis. Die Aussicht ist die Mühe wert.
Strecke: Alesätno - Vistas-Hütte ca. 20 km
Höhenunterschied: + 800 m, -1000 m
Dauer: normal zwei Tagesetappen mit Übernachtung in der Mårma-Hütte
Leicht bis mittelschwer
schöne Ausblicke, geologische Besonderheiten
Etappe Alesätno-Mårma-Hütte
Der Weg, der hier beschrieben wird, beginnt bei der Brücke über den Alesätno, der über den Weg nr. 5 einen
Kilometer nördlich davon erreicht wird. Dies ist eine ältere Brücke. Nach einer kurzen Strecke auf einem
Weg durch den Birkenwald kommt man hoch auf gerade, unbewaldete und leicht begehbare Kisterassen, die zur
selben eiszeitlichen Ablagerung gehören wie der lange Hügel weiter westlich im Alisvaggi. Die Kiesterrassen
enden mit einem einem kleinen Steilhang nach Osten, und unterhalb liegt der Schwemmkegel des
Vierrujohka, der schön ausgebildet ist. von der Kante sieht man deutlcih mehrere trockengefallene
bachbetten, die sich fächerförmig vom glitzernden Bach ausbreiten.
... In der Forstezung folgt man dem leichtbegehbaren Weg entlang dem lauf des Vierrujohka und erreicht den
Weg Nr. 6 bei der Brücke über diesen Fluß. Die Brücke wird überquert und unmittelbar danach biegt man vom Weg
ab, um parallel zum Fluß flußaufwärts an seinem Ostufer zu gehen. nach ein paar Kilometern kommt man an einer
abgeschlossenen Rentierwächterhütte vorbei. Die Aussicht zum Kåtotjåkka (1991 m) im Westen ist großartig und
man kann den gipfel an seiner Höhe und From (wie ein Dach (?)) leicht erkennen. Nach vorne sieht man das
einsame tal in das Mårmamassiv hinein, wo das Tal blind bei einem Walfischrücken-Kamm endet, dem
Vassacohkka (1725 m), der den Paß ausmacht. Mit dem fernglas kann man unterhalb des Kammes die Mårma-Hütte
erkennen. Nach Osten erkennt man den Alep Välivare (1528 m), der von hier aus ein bescheidenerer Bergklumpen
ist, wenn man mit dem Anblick vom Alisvaggi aus vergleicht.
Die Wanderung geht weiter auf einem unterschiedlich stark ausgetretenen Weg. Auf dem ersten Stück hinter der
Brücke wächst Heide, weiter oben dominieren steinige Grasböden. Der Vierrujohka ist ein starker Fluß, der sich
einen sehenswerten Canyon direkt am Weg gegraben hat. Der Blick in Richtung Mårmamassiv wird weiter, je höher
hoch man kommt. Ein paar Kilometer vor der Mårma-Hütte sieht man zwei von Lapplands spitzesten Gipfeln,
nämlich der Große und der Kleine Hök-Gipfel, 1865 m und 1855 m. Sie ragen über den Berghang wie Reißzähne.
Zur Hütte hin werden die Blöcke mehr, und bevor man sie erreicht, geht man um einen kleinen Steilhang herum.
Strecke: ca. 10 km
Höhenunterschied: + 460 m
Dauer: 3-4 Stunden
Leicht
Diese verlockende Berghütte liegt in einer Umgebung, die sowohl einsam, schwerzugaänglich und schön hochalpin ist.
Sie ist klein und vom selben Typ wie eine Schutzhütte, mit zwei Pritschen. Außerdem gibt es einen Vorratsschuppen
und ein Trockenklo. Die Umgebung ist großartig, auch wenn die Bergkämme von der Hütte aus ziemlich abgerundet
aussehen. Man muß etwas höher steigen, um zu erkennen, welche besondere Bergwelt dies ist. Die Hütte liegt auf
einem hang, der nach Westen geneigt ist, und unterhalb fleißt ein Bach vom Moarhmma-Gletscher in einen kleinen
Felscanyon. Der Bach kann beschwerlich werden für Wanderer, die direkt nach Westen aufsteigen wollen.
Die Hütte ist ein perfektes Basislager für Hochgebirgstouren, z.B. zum Vierrucohkka (1736 m), der einfach
entlang dem Kamm oberhalb der Hütte bestigen werden kann. ... Vom Vierrucohkka kann man weitergehen zum
Rassepautastjåkka (1750 m), der wahrscheinlich sehr selten bestiegen wird. Vom Punkt 1628 im Südwesten
geht man direkt hinab in das breite, namenlose Tal südlich des Massives, wo der Leavasjohka fließt. Man folgt
dem tal nach Westen zurück zur Hütte. Der Gipfel 1468, der das tel in der Mitte versperrt, kann auf der
nordöstlichen, steilen Seite passiert werden. ...
Strecke: ca. 20 km
Höhenunterschied: + 600 m
Dauer: 7-8 Stunden
Leicht
Die Steigung hoch zum Mårmapaß von der Hütte ist erst gering, aber die obersten 200 m sind sehr steil. Die
Südseite des Passes ist weniger steil. Hier geht man über ein Blockfeld mit gras zwischen den Steinen. Der
Abstieg zum Vistasvaggi ist lang und zieht sich hin. Man wandert erst hinunter in eine Mulde und geht in
Richtung des Sees Vassajavri, wo man eine schöne Aussicht in das geschlossene und abgelegene Tal östlich vom
Vassacorru (1791 m) hat. Das Tal verlockt zu einem Besuch, und wenn man es schafft, in diesem Kessel einen
Grasfleck zu finden (hier liegen viele Blöcke), hat man einen perfekten Ausgangspunkt für Hochgebirgstouren
im Massiv. Normal geht man jedoch nicht dahin, sondern geht weiter in richtung Vistasvaggi.
Aus dem Vistasjavri fließt ein Fluß, der einige hundert Meter vom Auslauf am See durchwatet wird. Danach
umrundet man die Bergkante Vassajunnji und geht steil hinunter zum See Vassaloamijavri, wo man leicht
Zeltplätze finden kann. Vom Hang aus sieht man hohe Berge im zentralen Kbenkaisegebiet, z.B. Nipals (1902 m)
und die Pyramide (1900 m). Der See liegt schön eingerahmt von Rücken nach Süden und Westen. Man geht hinauf
über den westlichen Rücken und bekommt eine herrliche Aussicht über das Vistasvaggi und das Stuor Reaiddavaggi
mit den umgebenden Hochgebirgsmassive. Unter anderem kann man den Felsturm Seitak (1665 m) studieren in einer
imponierenden Perspektive. Von hier liegt noch ein beschwerliches Terrain vor einem auf dem Weg hinunter ins Tal.
Entlang der Waldgrenze gibt es kniehohe Weiden. Man hält sich schräg oberhalb des Waldes und geht nach Westen,
bis man direkt oberhalb der Vistas-Hütte herauskommt. Mit etwas Glück findet man den Weg, der von der Hütte
kommt. Sonst muß man sich selbst den Weg bahnen auf der kilometerlangen Strecke durch fruchtbaren Birkenwald
bis zur Hütte.
Strecke: 14 km
Höhenunterschied: + 440 m, -1010 m
Dauer: 5-6 Stunden
Mittelschwer